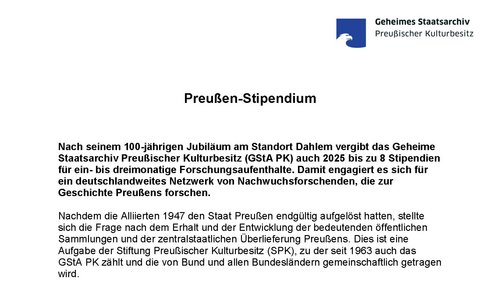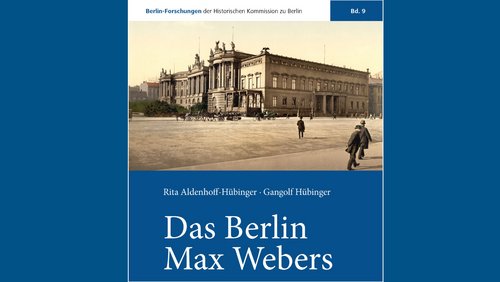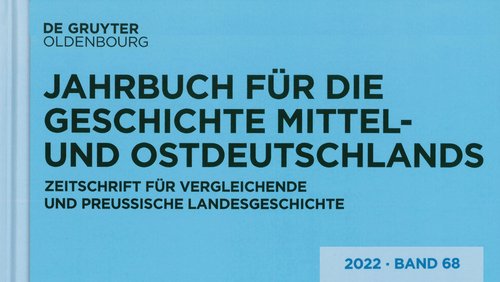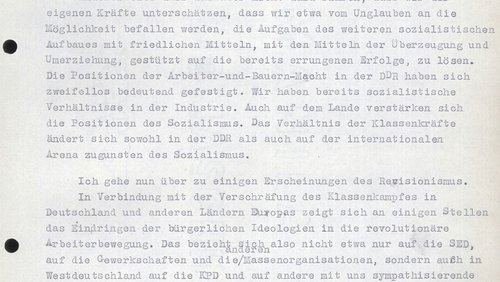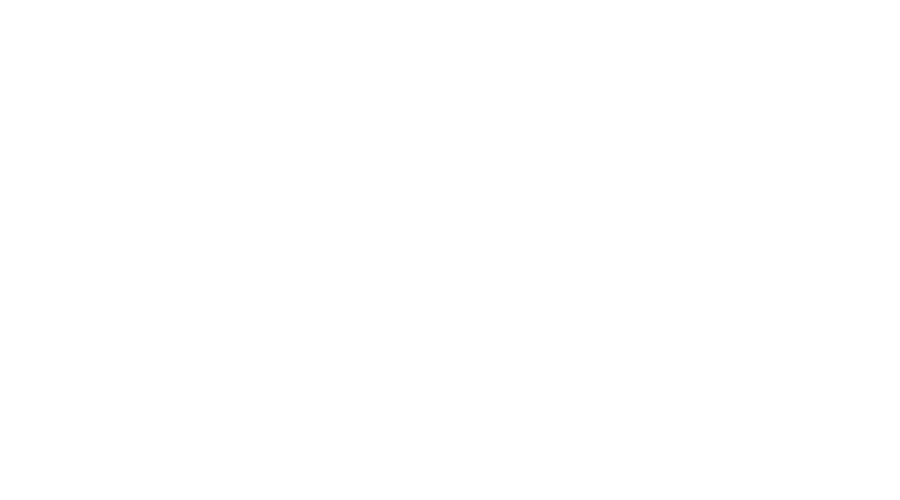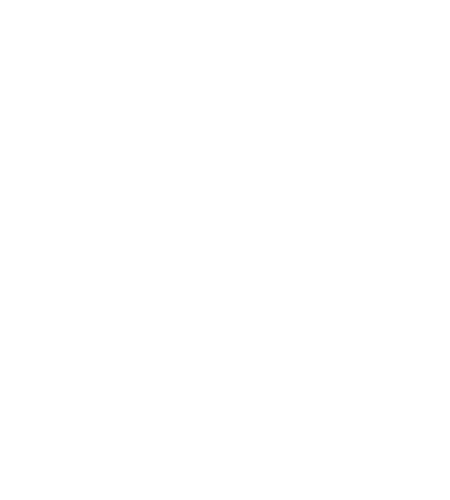Geschichte aus erster Hand –
Herzlich willkommen bei der Historischen Kommission zu Berlin!
Die Historische Kommission zu Berlin e.V., wiederbegründet 1959, ist eine wissenschaftliche Vereinigung. Sie fördert und initiiert Forschungen auf dem Gebiet der Landesgeschichte Berlin-Brandenburgs sowie Brandenburg-Preußens durch wissenschaftliche Projekte, Publikationen, Vorträge, Tagungen und andere öffentliche Veranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie hier.